Ich bin ein Geländer am Strome: fasse mich, wer mich fassen kann!
Vom Geländer über die Peitsche bis zum Regenschirm, den der Philosoph in Turin vergass, erfährt man auf diesem Symposium von den kleinen Dingen, die Nietzsche von einer sehr menschlichen Seite zeigen.
Als Denkkünstler und Kunstdenker lebt Nietzsche weiter. Es werden Wirkungen von Nietzsches Umwertung aller Werte auf Malerei (Ernst Ludwig Kirchner), auf Musik (Wolfgang Rihms „Dionysos“ 2010), auf Dichtung heute (Thomas Hürlimann) bedacht.
Das erholsame Ambiente im Grand Resort Bad Ragaz mit Park in voralpiner Landschaft sorgt für alle Sinne. Auf ein anregendes Symposium mit Begegnungen und Gesprächen freut sich
Ihr
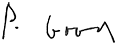
PROF. DR. PAUL GOOD, PHILOSOPHIE ATELIER BAD RAGAZ
16.00 uhrNIETZScHES DIÄTETIScHES PHILOSOPHIEREN — ÜBER wANDERN, GESUNDHEIT, KLIMA, ERNÄHRUNG
prof. dr. paul good, bad ragaz | eröffnungsvortrag im grand hotel quellenhof
17.30 uhrNIETZScHES WERk IM ÜBERBLICK — EINE WERkkARTOGRAPHIE
dr. rüdiger schmidt-grépály, leiter des kollegs friedrich nietzsche der klassik stiftung weimar | vortrag
19.00 uhrAPÉRO UND BEGRÜSSUNG
peter paul tschirky, ceo grand resort
20.00 uhrABENDESSEN, BEGEGNUNG UND GESPRÄCHE
09.45 uhrDER kUNST-FALL NIETZScHE ODER DIE wIEDERGEBURT DES DENkENS AUS DEM GEIST DER SINNE
prof. dr. rüdiger görner, london | vortrag
11.15 uhrKAFFEEPAUSE
11.30 uhrJENSEITS DER PEITScHE, ODER: EINIGE ANNOTATIONEN ZU NIETZScHE, LOU ANDREAS-SALOMé, META VON SALIS UND HELENE DRUSkOwITZ
prof. dr. ursula pia jauch, zürich | vortrag
13.00 uhrNAcHMITTAG ZUR FREIEN VERFÜGUNG FÜR DIE TAMINATHERME, ZUM wANDERN IN DIE TAMINA- ScHLUcHT, DURcH DIE wEINBERGE, ZUM LESEN
13.00 uhr„…UNABLäSSIGES SPIEL DER DOPPELBELICHTUNGEN“ — WOLFGANG RIHMS OPERNPHANTASIE „DIONYSOS“ NACH FRIEDRICH NIETZSCHES DIONYSOS-DITHYRAMBEN (MIT TON- UND BILD- BEISPIELEN DER SALZBURGER PREMIERE 2010)
pd dr. ulrich mosch, paul sacher stiftung basel | vortrag
20.00 uhrABENDESSEN, BEGEGNUNG UND GESPRÄCHE
09.45 uhr„DER LEIB IST EINE GROSSE VERNUNFT“ — „DER ScHAFFENDE“ ALS MODELL FÜR DAS MENScHSEIN
prof. dr. paul good, bad ragaz | vortrag
11.15 uhrKAFFEEPAUSE
11.30 uhrNIETZScHE UND DIE BILDENDEN kÜNSTE DES ExPRESSIONISMUS, INSBESONDERE BEI „BRÜckE“ UND ERNST LUDwIG kIRcHNER
dr. wolfgang henze, bern /
/ wichtrach | vortrag
wichtrach | vortrag
12.45 uhrVORBEREITUNG FÜR DIE ExkURSION
13.15 uhrABFAHRT DES BUSSES ZUM kIRcHNER MUSEUM IN DAVOS
14.15 uhrkAFFEEPAUSE IN DAVOS
14.15 uhrFAHRT ZU HAUPTANSIcHTEN VON kIRcHNER-MOTIVEN IN DER REGION DAVOS UNTER DER LEITUNG VON DR. wOLFGANG HENZE
16.00 uhr„IM HERZEN DES MUSEUMS 3: FORScHEN“ – wAS kUNSTwISSENScHAFT MIT ANDEREN wISSENScHAFTEN VERBINDET
besichtigung des kirchner museums in davos mit einer führung durch die ausstellung
17.00 uhrRÜckFAHRT NAcH BAD RAGAZ
20.00 uhrABENDESSEN, BEGEGNUNG UND GESPRÄCHE
PAUL GOOD
NIETZScHES DIÄTETIScHES PHILOSOPHIEREN — ÜBER wANDERN, GESUNDHEIT, KLIMA, ERNÄHRUNGFriedrich Nietzsche war ein Wanderer. Sein sehr fragiler Gesundheitszustand fand im Gehen die Balance. Die Sommer im Engadin und die Winter in Norditalien boten ihm jenes trockene Klima, das seinem Denken freien Lauf ließ. Seine Devise war: Misstraue jedem Gedanken, der nicht erlaufen worden ist. Sitzfleisch ist Sünde wider den heiligen Geist. Die piemontesische Küche lobte er als die beste. Er betrieb ein diätetisches Philosophieren, das den physiologischen Bedingungen für körperliche und geistige Gesundheit volle Aufmerksamkeit schenkte. Er befand, „Wasser reicht“, weil Wein ihn ermüdete. Gedanken wollen erlaufen sein. Seine Bücher bezeichnete Nietzsche im Rückblick als Höhenluftbücher. Die dünne Luft darin verträgt nicht jeder. Nietzsche berichtet auch fast in jedem Brief über Schmerz, Krankheit, Klima, Wetter. Zur Eröffnung des Symposiums „Nietzsche in Ragaz“ erzählt Paul Good von physiologischen Bedingungen von Friedrich Nietzsches wanderndem Philosophieren. Diese waren schließlich auch der Grund, warum der Philosoph 1877 einen Monat lang in Bad Ragaz zur Kur weilte.
„DER LEIB IST EINE GROSSE VERNUNFT“ — „DER ScHAFFENDE“ ALS MODELL FÜR DAS MENScHSEIN
Gegen die Verächter des Leibes in Philosophie, Religion, Moral zieht Zarathustra zu Felde. Der alte Dualismus von Leib und Seele ist ihm ein Ärgernis. „Leib bin ich ganz und gar und nichts außerdem“. Seele sei nur ein Wort für etwas am Leibe, dem Nietzsche den Status einer „großen Vernunft“ zuerkennt, insofern der Leib „eine Vielheit mit einem Sinne“ ist. Der Leib sagt nicht „Ich“, aber er „tut Ich“. Er ist aktiv, der Repräsentant des „Würfelwurfs Kraft“, der mich definiert, während das Bewusstsein stets nur reaktiv ist. Das ist der Punkt, bei dem Nietzsche dem großen Holländer Spinoza folgte, den er stets als seinen Vorgänger bezeichnete. „Denn was der Körper alles vermag,“ schrieb Spinoza in seiner „Ethica“, „hat bis jetzt noch niemand festgestellt“. Ein früher Wink im Sinne von Hirn- und Genforschung? Nietzsche folgte Spinozas Affektenlehre, wonach die Affekte einander selber steuern. Die Regel heißt: positive Affekte (Lust) siegen über negative Affekte (Unlust), also über Rache- und Ressentiment-Gefühle (trübsinnige Leidenschaften). Hierin liegt der Ausgangspunkt von Nietzsches Kritik an der ganzen Leibfeindlichkeit und Ressentimentkultur. Aber auch seine Vorstellungen zum „Willen zur Macht“ ankern in seiner Leibphilosophie. Und beim „Schaffenden“, der neue Werte schafft, wird dieser Haushalt der Kräfte am ehesten einsichtig.
Paul Good lehrte 25 Jahre als Philosoph an der Kunstakademie Düsseldorf und ist mit Büchern zu Kunst und Philosophie hervorgetreten. Jetzt lebt er in Bad Ragaz, wo er 2010 eine Symposiums-Reihe begründet hat.
RÜDIGER SCHMIDT-GRÉPÁLY
NIETZScHES WERk IM ÜBERBLICK — EINE WERkkARTOGRAPHIE
Nach dem Empfang von „Menschliches, Allzumenschliches“ notiert sich Cosima Wagner in ihrem Tagebuch: „Diesen Autor kennen wir nicht.“ Hundert Jahre vor Jaques Derrida stellt das Ehepaar Wagner den einen Autor Friedrich Nietzsche in Frage. Und tatsächlich ist nicht ausgemacht, was sich hinter dem Autorennamen „Nietzsche“ verbirgt. Der Vortrag wird versuchen, einen Wegweiser durch die Gedankenlandschaften zu erstellen. Einen Wegweiser, der zunächst ins antike Griechenland verweisen wird, in ein Griechenland so ganz anders als sich Winckelmann und Goethe nachträumten. Ein Wegweiser, der „Menschliches, Allzumenschliches“ fast bis ins Paris der Aufklärung führt. Einen, der über Persien weit in die Zukunft weist und schließlich einen, der uns genealogisch zurückführt in die Geschichte all unserer Vorurteile. Zu fragen bleibt: Was aber passiert ab dem Moment, in dem wir in den Notizbüchern Nietzsches einen Plan finden mit der Notiz: „Willen zur Macht“?
Rüdiger Schmidt-Grépály ist Gründer und seit 1999 Leiter des Kollegs Friedrich Nietzsche der Klassik Stiftung Weimar. Er hat sich mit zahlreichen Büchern zu Nietzsches Werk international einen Namen gemacht und genießt den Ruf des Fröhlichen Freidenkers.
RÜDIGER GÖRNER
DER kUNST-FALL NIETZScHE ODER DIE wIEDERGEBURT DES DENkENS AUS DEM GEIST DER SINNEDieser Beitrag geht von folgender These aus: Nietzsches Denken rehabilitierte die Sinne, die er selbst dann noch bejahte, wenn ihre defizitäre Weltwahrnehmung nur ‚verzerrte‘ Eindrücke der Umgebung erlaubte. Damit stellte er sich gegen eine ganze sinnenskeptische bis -feindliche Denktradition, die sich vor allem mit dem kritischen Rationalismus cartesianischer Prägung verbindet. Mehr noch: Nietzsche strebte ein Sinnendenken an, das Gehör und Geruch, Berührung und Anschauung zu Reflexionsmedien erklärte. Gerade deswegen konnte die Kunst für ihn eine solchermaßen überragende Bedeutung gewinnen, vermittelt sich doch in der Kunst Gestaltsinn und Sinnengestalt, Leben und Geist zu einer anderen, sprich: eigenständigen Verwirklichung des Inneren als ein erkennbar Äußeres. Dieser Vortrag versucht eine Grundlegung dieser ästhetischen Verhältnisse in (und durch) Nietzsches Denken.
Rüdiger Görner lebt seit 1981 in London und ist Professor of German Literature and Founding Director of the Centre for Anglo-German Cultural Relations am Queen Mary College, University of London. Mit mehreren Büchern hat er sich auch mit Nietzsche als Denkkünstler und als Kunstdenker große Verdienste und weltweite Beachtung erworben.
URSULA PIA JAUCH
JENSEITS DER PEITScHE, ODER: EINIGE ANNOTATIONEN ZU NIETZScHE, LOU ANDREAS-SALOMé, META VON SALIS UND HELENE DRUSkOwITZViel Druckerschwärze ist schon vergossen worden zur Frage, ob – und weshalb? – Friedrich Nietzsche als gefeierter „Philosoph des Leibes“ ein besonderes Verhältnis zu den Frauen gehabt habe. Da gibt es zunächst einmal die zu rekonstruierenden Ereignisse, dann die zirkulierenden Gerüchte, auch sie sind klärungsbedürftig. Eine der gern kolportierten Legenden, die eine Verbindung zwischen dem Leben und dem Werk des Philosophen suggerieren, hat mit einem an sich „weltlichen“ Gegenstand zu tun – mit einer Peitsche. Jedenfalls wird die Stelle aus dem Zarathustra – „Du gehst zu den Frauen? Vergiss die Peitsche nicht!“ – schnell mit einem sonderbaren fotografischen Dokument in Verbindung gesetzt, das sich aus Nietzsches Leben „nach“ den Basler Jahren erhalten hat: Lou von Salomé sitzt in einem Leiterwagen, mit herausforderndem Lächeln schwingt sie eine Karikatur von einem Peitschchen, derweil Paul Rée und Friedrich Nietzsche sich an der Deichsel des Wägelchens zu schaffen machen. Das ganze Bild (inklusive des kleinen Fliedersträusschens, das bei genauem Hinsehen an der Peitsche sichtbar wird) wurde von Nietzsche selbst arrangiert, und zwar im damaligen Alpenpanorama gegenüber dem Luzerner Löwendenkmal. Ausgehend von diesem nicht unbekannten Stück Luzerner Lokalgeschichte möchte ich auf eine weitere helvetische Nietzsche-Verbindung eingehen, die im Bündnerland spielte. Konkret: Wie konnte es geschehen, dass just zwischen Meta von Salis-Marschlins, einer der ersten Frauenrechtlerinnnen der Schweiz, und dem als Frauenfeind etikettierten Friedrich Nietzsche ein intensiver Briefwechsel, ja sogar die Spurlinien einer Freundschaft entstanden? Nicht alle freilich sahen in Nietzsche einen Befreier und neuen Edelmenschen. Zu erinnern ist des Weiteren an Helene von Druskowitz, frühe Nietzsche-Freundin und später eine der radikalsten Nietzsche-Verächterinnen. Ist die vielgerühmte „Vernunft des Leibes“ vielleicht doch etwas eher Schillerndes und Arbiträres?
Ursula Pia Jauch lebt in Zürich, wo sie seit 2003 als Professorin für Philosophie und Kulturgeschichte an der Universität tätig ist. Sie hat in der Aufklärung einen Forschungs- und Publikationsschwerpunkt, wobei ihre Aufmerksamkeit der Geschlechterdifferenz gilt. Sie ist auch als Publizistin, Autorin und Moderatorin beim Schweizer Fernsehen aktiv hervorgetreten.
ULRICH MOSCH
„…UNABLäSSIGESSPIELDERDOPPELBELICHTUNGEN“ — WOLFGANG RIHMS OPERNPHANTASIE „DIONYSOS“ NACH FRIEDRICH NIETZSCHES DIONYSOS-DITHYRAMBENIm Jahre 2010 wurden die Salzburger Festspiele am 27. Juli mit der Uraufführung eines Werkes der zeitgenössischen Musik glanzvoll eröffnet – mit Wolfgang Rihms (geb. 1952) neuntem Musiktheaterwerk, der Opernphantasie Dionysos. Nietzsches Dionysos-Dithyramben hatten den Komponisten seit den siebziger Jahren fast ständig beschäftigt und hinterließen in verschiedenen Werken ihre Spuren. Die schon länger existierende Idee, die Texte als Ausgangspunkt für eine musikalisch-szenische Umsetzung zu nehmen, setzte er aber erst mit Dionysos (2009–10) in die Tat um. Auf der Grundlage eines eigenen Librettos, bei dem dennoch jedes Wort von Nietzsche ist, fasste er, wie er es selbst ausgedrückt hat, die «einander durchkreuzenden Assoziationsfelder» der Dithyramben «in schwankende Gestalten». Der Vortrag stellt dieses komplexe Werk anhand von Ausschnitten im Kontext von Rihms Œuvre und Schaffenspoetik vor.
Ulrich Mosch ist seit 1990 Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Paul Sacher Stiftung in Basel, wo er zwei Dutzend Nachlässe und Sammlungen von zeitgenössischen Komponisten, auch die Kompositionen von Wolfgang Rihm, dessen Schriften und Gespräche er herausgab, betreut. Er gilt als bester Kenner von Rihms Werk. Er lehrt und publiziert in Musikgeschichte und Musikästhetik.
WOLFGANG HENZE
NIETZScHE UND DIE BILDENDEN kÜNSTE DES ExPRESSIONISMUS, INSBESONDERE BEI „BRÜckE“ UND ERNST LUDwIG kIRcHNERBekannt ist, dass auch die bildenden Künstler des Expressionismus Nietzsches Schriften lasen und bisweilen auswendig deklamierten. Daher wurden sie von einigen Nietzsche-Kennern und Verehrern fest vereinnahmt. Wo jedoch zeigen dessen Gedanken aber tatsächlich direkt erkennbare Wirkung in den Werken und in der Theorie der Maler und Bildhauer? Werk vor Theorie, zumindest bei „Brücke“, das ist hier ein wesentlich unterscheidendes Faktum. Wo also scheinen Gedanken Nietzsches in den Kunstwerken auf und wie werden diese visualisiert und umgesetzt. Dieser Versuch geht nicht von den Schriften und Gedanken Nietzsches aus, sondern von Werk und Theorie der Maler und Bildhauer an Hand ausgesuchter Beispiele.
Wolfgang Henze promovierte 1969 an der Ludwig Maximilians-Universität München in Kunstgeschichte und betätigt sich seither insbesondere als Galerist und Kunsthändler, spezialisiert auf Ernst Ludwig Kirchner, die „Brücke“ und Expressionismus, aber auch auf Abstraktion und Figuration der 50er Jahre und später. Er trat mit wichtigen Publikationen in Katalogen und mit dem Aufbau von Künstlerarchiven kunstwissenschaftlich hervor.
THOMAS HÜRLIMANN
„NIETZScHES REGENScHIRM“Auch Schriftsteller haben Lieblingsdinge: zum Beispiel den Regenschirm. Zunächst ist er für alle ein nützliches Utensil, das vor Unbeständigkeit des Wetters schützt. Bei der alten Wendung „Unter deinem Schutz und Schirm“ schwingt noch etwas anderes, Umfassenderes mit: ein Ort, wo Menschen sich geborgen und geschützt fühlen vor äußeren Heimsuchungen und inneren Ängsten. Der Schirm reizt als Alltagsgegenstand und als metaphysisches Requisit. In der grotesken Komödie „Der letzte Gast“ prägte die Fabrikation von Regenschirmen das Schicksal der Hauptfigur.
So wurde eine der letzten Äußerungen Friedrich Nietzsches zu einer Quelle des hintersinnigen Sinns: „Ich habe meinen Regenschirm in Turin vergessen.“ Was verlor Nietzsche alles mit seinem Regenschirm?
Thomas Hürlimann aus Zug lebt heute in Berlin. Er gehört zu den bekanntesten Schriftstellern der Schweiz. Sein Schaffen umfasst Prosa und Theaterstücke, die in viele Sprachen übersetzt und mit Preisen bedacht wurden. Die provokativen Bilder seines Einsiedler Welttheaters 2000 und 2007 lösten heftige Kontroversen aus. In einem Interview bezeichnete er sich selbst als „konservativen Anarchist“. Zu den wichtigsten Stücken zählen „Grossvater und Halbbruder“ 1981, „Stichtag“ 1984, „Der letzte Gast“ 1990, „Der Gesandte“ 1991, „Das Lied der Heimat“ 1998 und „Synchron“ 2001. 2008/2009 wurde sein Roman „Der grosse Kater“ mit Bruno Ganz in der Hauptrolle verfilmt. Weitere Werke sind „Die Tessinerin“, „Das Gartenhaus“, „Fräulein Stark“, „Vierzig Rosen“ und „Dämmerschoppen – Geschichten aus 30 Jahren“.
![]()



